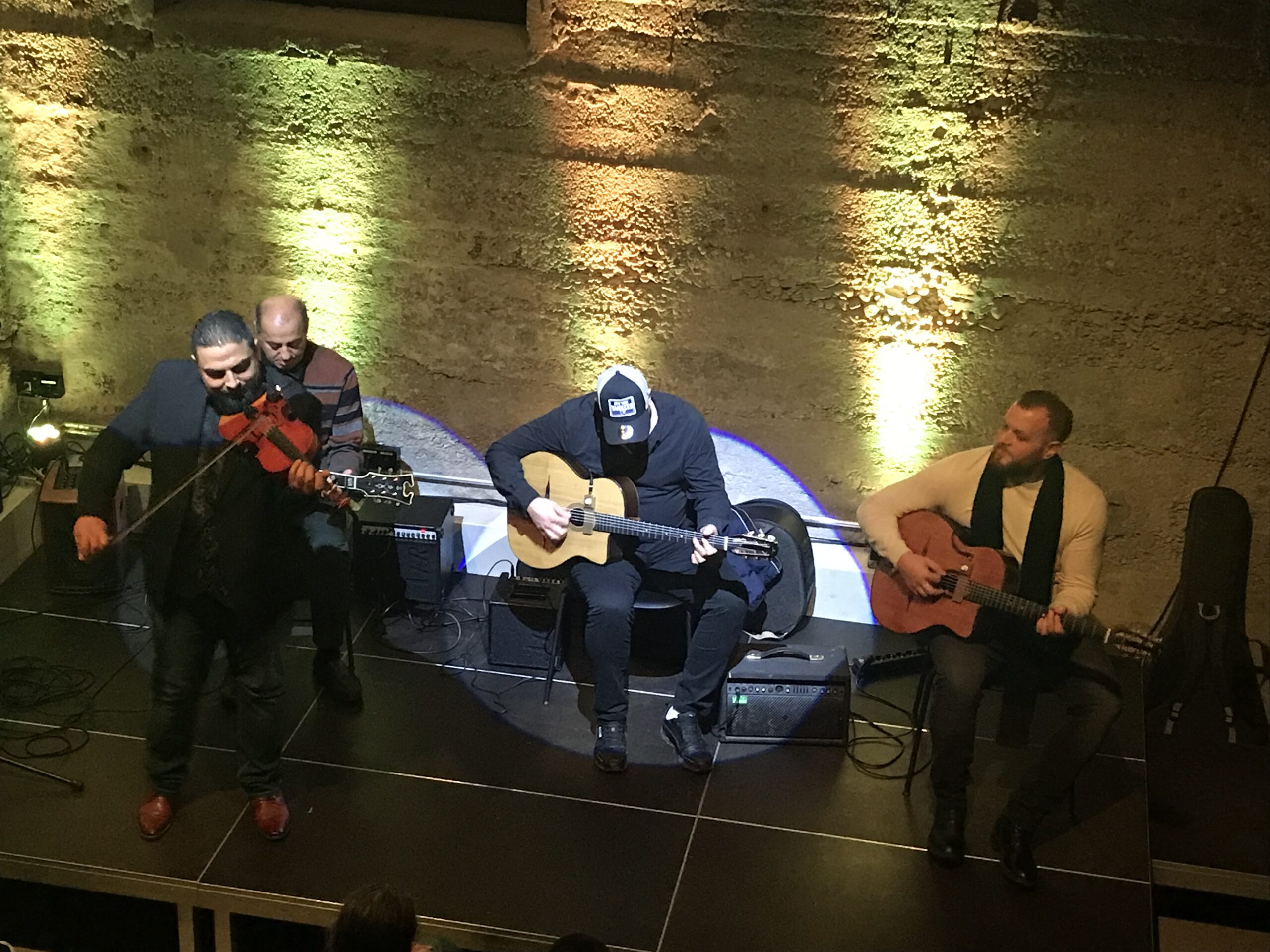In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau wurde am 2. August 2025 an die Ermordung der letzten noch lebenden Angehörigen der Sinti und Roma im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau vor 81 Jahren erinnert. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden 4300 Sinti und Roma, überwiegend ältere und kranke Menschen sowie Kinder, von der SS gegen ihren erbitterten Widerstand in die Gaskammern von Auschwitz getrieben. Das Europäische Parlament erklärte im Jahr 2015 den 2. August zur Erinnerung an die 500.000 Angehörigen der Minderheit, die im NS-besetzten Europa ermordet wurden, zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Aus Anlass des zehnten Jahrestages dieser Entscheidung wurde diesmal die europäische Perspektive in den Mittelpunkt gerückt. Und deshalb hat auch eine international besetzte Delegation des Europarates an der Veranstaltung teilgenommen.

„Der Rassismus der Nazis führte in die Entmenschlichung der Vernichtungslager. Der Rassismus unserer Tage – wie Antiziganismus und Antisemitismus – führt zur Zerstörung unserer demokratischen Gesellschaft. Dagegen müssen wir eine Menschlichkeit setzen, die ihre Kraft aus diesem Ort des unaussprechlichen Grauens und der absoluten Hoffnungslosigkeit zieht. Auschwitz darf seine moralische Kraft niemals verlieren!“, warnt der Vorsitzende des Zentralrates und des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, bei der zentralen Gedenkfeier, die der Zentralrat gemeinsam mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma sowie dem Verband der Roma in Polen und in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau organisiert.
Mit „Angst und Sorge“ beobachtet der Zentralrat die weltweiten politischen Entwicklungen. Nationalistische und rechtspopulistische Bewegungen treiben die Spaltung Europas immer weiter voran. Sinti und Roma, wie auch Juden und andere Minderheiten, sind heute einer neuen Dimension von Nationalismus, Rechtsextremismus und Rassismus ausgesetzt, bei der brutale Gewalt wieder zum Alltag gehört. Holocaust-Gedenktagen kommt dabei eine wichtige Rolle zu, weil sie eine fortwährende Mahnung sind, uns für Menschenrechte und Menschenwürde einzusetzen.
Romani Rose: „Menschenrechte werden aber dann zu hohlen Begriffen, wenn wir zulassen, dass Flüchtlinge in der Wüste verdursten oder im Meer ertrinken, wenn wir schweigend hinnehmen, dass Kinder im Gazastreifen verhungern und man dies dann zynisch als ‚Kollateralschäden‘ abtut. Noch leben wir in der Gewissheit der Einmaligkeit der ungeheuerlichen Nazi-Verbrechen. Jeder Vergleich mit anderen Taten und seien sie noch so schrecklich, ist unzulässig, weil er das Ungeheuerliche, das Monströse des Holocaust, relativieren würde.“
Von den deutschen Sicherheitsbehörden erwartet Rose, dass sie 80 Jahre nach der Nazi-Herrschaft, endlich ihr verfassungswidriges Verhalten aufgeben und Sinti und Roma nicht länger auf Grundlage ihrer Abstammung – nach dem Vorbild der Nazis – antiziganistische erfassen und kriminalisieren. Angesichts der „Vernichtungsmaschinerie“ von Auschwitz, mit dem Wissen um die Ermordung von 500 000 Sinti und Roma und sechs Millionen Juden, fordert Rose eine „menschliche Politik“ ein: „Damit sich Auschwitz niemals wiederholt – das ist das Vermächtnis der Opfer an uns alle.“


Der Holocaust-Überlebende Dieter Flack erinnert an seine Angehörigen, die im Mai 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert und wenige Wochen später vergast wurden. Seine Familie konnte sich durch Flucht vor den NS-Schergen retten und versteckte sich über Monate in Wäldern. Der 84-Jährige wandte sich in seiner Rede insbesondere an junge Menschen: „Bedauert habe ich nach Ende des Zweiten Weltkrieges lange Zeit, dass für mich als Sinto der Zugang zur Bildung so viel schwerer war als für Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Ich hätte so gern länger und mehr gelernt. Deshalb möchte ich an die Jugend appellieren: Nutzt jede Gelegenheit Euch weiterzubilden, lernt vor allem Sprachen und lernt andere Länder und Kulturen kennen. Denn das trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen und ein Klima der Toleranz und Akzeptanz zu schaffen.“
Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Theodoros Rousopoulos, mahnt in seiner Rede am Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma: „Wir können uns und andere weiterbilden und dabei den Funken der Hoffnung in uns tragen, dass sich die Geschichte nicht wiederholen wird.“
Martin Hojsík, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, erinnert in seiner Ansprache an die Ceija Stojka: „Diese Überlebende des Holocaust an den Sinti und Roma, die 1943 hierherkam, sagte einmal: ,Ich fürchte, Auschwitz schläft nur.’ Wir dürfen nicht zulassen, dass es wieder erwacht. Gemeinsam müssen wir weiterhin die europäischen Werte bewahren, die uns Sicherheit geben: Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Gleichbehandlung aller Menschen.”
Und Holger Mahnicke, der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Krakau, stellt fest: „Eine zentrale Verantwortung kommt auch den Medien zu, denn sie spielen bei der Reproduktion und Verstärkung von antiziganistischen Stereotypen, Diskursen und Narrativen eine besondere Rolle. Und dies erfolgt nicht unbedingt in offener Form, sondern auf viele verschiedene Arten codiert und nicht einmal unbedingt beabsichtigt.“ .“

Die Gedenkveranstaltung wurde live über die Website https://www.roma-sinti-holocaust-memorial-day.eu/ gestreamt. Das Video ist dort dauerhaft mit einem breiten Informationsangebot (DE/EN/PL/Romanes) zum Holocaust an der Minderheit verfügbar.