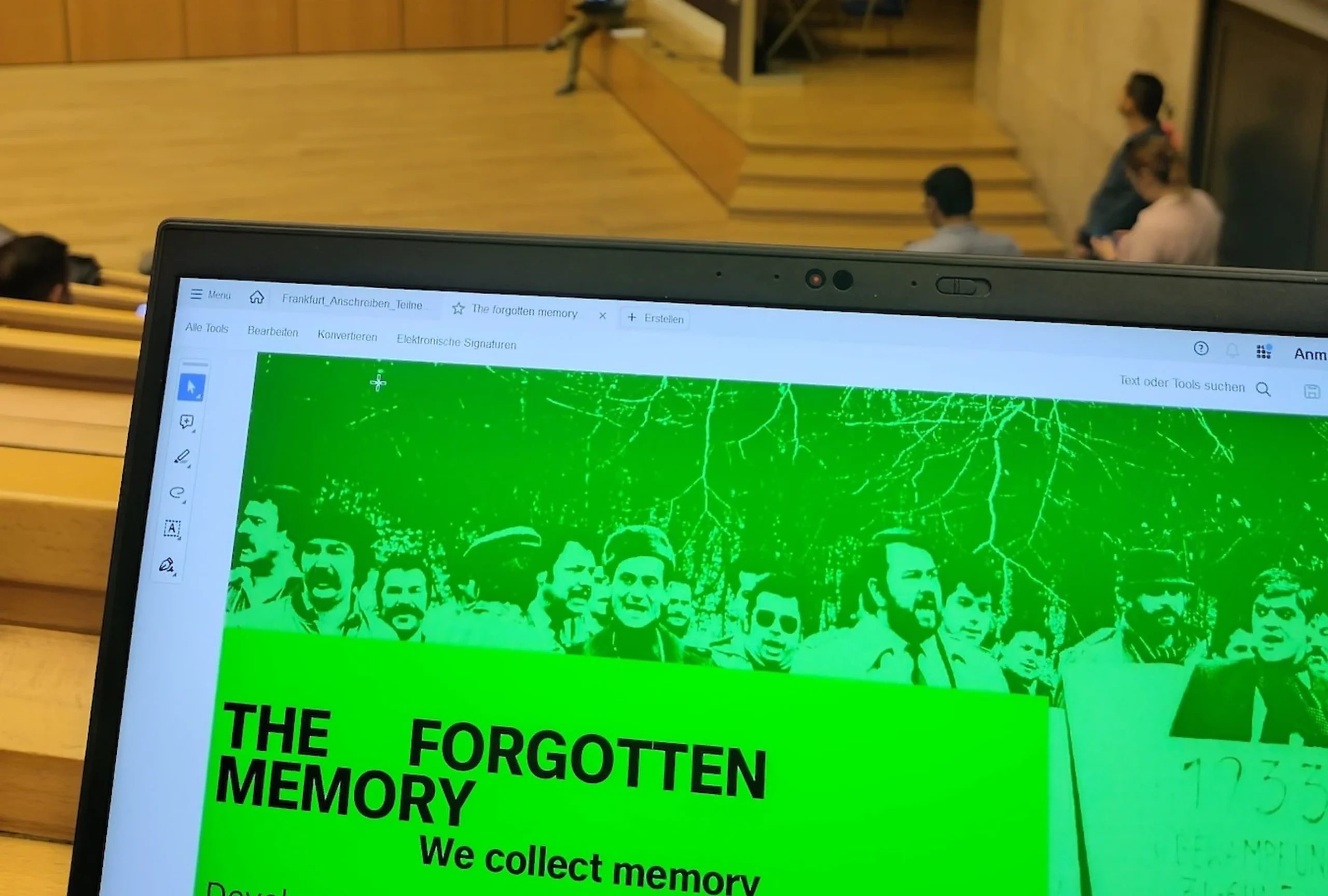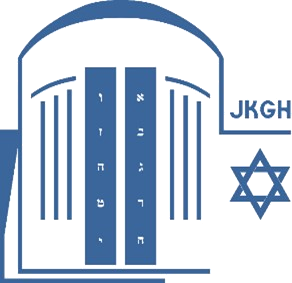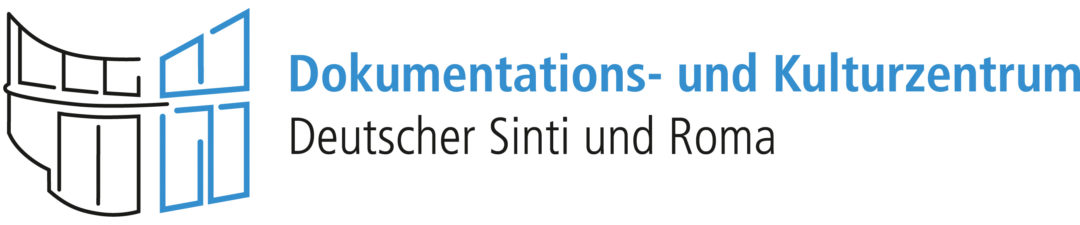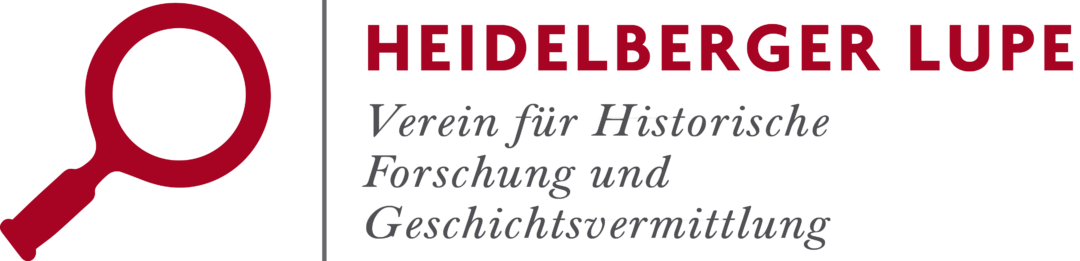Seit Frühjahr 2022 treffen sich Angehörige der Sinti und Roma mit jüdischen Familien, um über ihre familiäre Erinnerungskultur zur nationalsozialistischen Verfolgung zu sprechen. Gerade die Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen wird für die Nachfolgegeneration immer wichtiger. Traumatische Erfahrungen in den Familien sollen gemeinsam aufgearbeitet werden.

Das Heidelberger Bündnis „Gemeinsam Zeitzeugenschaft im Generationswechsel begegnen“ unter der Federführung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma bringt erstmals Überlebende der Sinti und Roma und Jüdinnen und Juden aus dem Raum Heidelberg zusammen. Ihnen ist die Erfahrung des nationalsozialistischen Unrechtsstaates gemeinsam, in dem ihre Angehörigen verfolgt und ermordet wurden. Nach 1945 mussten beide Gruppen lernen, sich mit dem rassenideologischen System des NS-Staates und dem staatlich betriebenen Völkermord auseinanderzusetzen. Ihre Erfahrungen mit Antiziganismus und Antisemitismus enden jedoch nicht in der Vergangenheit. Sie sind auch heute noch, fast acht Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur in Deutschland, im Alltag erlebbar.
Das Besondere des Bündnisses liegt darin, dass es Überlebende und ihre Nachkommen aus mehreren Generationen zusammenbringt, um den Dialog zwischen den verfolgten Gruppen anzuregen und die Nachfolgegenerationen zu stärken. Der Ansatz des Bündnisses besteht darin, in einem geschützten Rahmen den Austausch zwischen beiden Gruppen zu ermöglichen und so einen neuen Zugang zur historischen Aufarbeitung zu schaffen. Die Überlebenden sind hochbetagt und leiden unter den Erinnerungen an die NS-Zeit, während die Nachfolgegenerationen auf der Suche nach ihrer Identität in Deutschland sind und Bedarf an Aufarbeitung und Klärung haben. Das Bündnis möchte diese Lücken füllen, indem es Überlebende und Nachfolgegenerationen zusammenführt, neue Zugänge zur historischen Aufarbeitung schafft und den Überlebenden dabei hilft, ihre Geschichten zu teilen.
Beim ersten Workshop am 15. Mai 2022 in der Jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg trafen sich beide Gruppen erstmals. Die älteste Teilnehmerin war 83 Jahre alt, die jüngste 17 Jahre. Schnell wurde deutlich, dass beide Gruppen gerne mehr über die ihnen noch unbekannte Geschichte und Kultur des anderen erfahren wollten. Seitdem haben zwölf Begegnungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten stattgefunden.
Zwei besondere Treffen sind hervorzuheben: Ein Filmabend im Dokumentationszentrum, bei dem der Film „Gipsy – Die Geschichte des Boxers Johann Rukeli Trollmann“ von 2012 gezeigt wurde, mit Hannelore Elsner in der Hauptrolle und Hannes Wegener in der Rolle des Trollmann. Der Film verdeutlichte das gemeinsame Schicksal von Sinti und Roma sowie Jüdinnen und Juden in Europa unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, wie die Anwesenden einstimmig feststellten. Mit einer Gedenkfahrt zum Erinnerungsort „Europäisches Zentrum des deportierten Widerstandskämpfers. Ehemaliges Konzentrationslager Natzweiler-Struthof“ wurden die Trauer und Wut angesprochen, die ihnen zugefügt wurden. Durch den Besuch sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Heidelberger Bündnisses einander nähergekommen.
Ein Workshop mit Dr. Kurt Grünberg behandelte die „Transgenerationale Tradierung eines extremen Traumas“. Grünberg hat sich am Frankfurter Sigmund-Freud-Institut auf das Forschungsgebiet „Psychosoziale Spätfolgen der nationalsozialistischen Judenvernichtung in Deutschland“ sowie „Szenisches Erinnern der Shoah“ spezialisiert.
Das Bündnis umfasst verschiedene Aktivitäten, darunter „Biographie-Workshops“ unter der Moderation der Theaterpädagogin Frau Nedjma Schreiner sowie die Dokumentation der Ergebnisse mit Unterstützung weiterer Bündnispartner. Der Verein „Heidelberger Lupe, Verein für historische Forschung und Geschichtsvermittlung“ unterstützt das Bündnis fachkundig bei der biografischen Spurensuche und der Regelung ihres biografischen Vermächtnisses. Der Verein „Mosaik Deutschland e.V.“ stellt Zugang zu lokalen zivilgesellschaftlichen Akteuren her, die das Bündnis bei der Erreichung seiner Ziele unterstützen. Dank seiner Koordinationskompetenz können Kooperationsstrukturen und Organisationsabläufe professionell begleitet werden.
Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg ermöglicht den Zugang zu Netzwerken und weiteren Kooperationspartnern in der vielfältigen Stadtgesellschaft. Die Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg unterstützt das Bündnis wissenschaftlich und fördert den Transfer seiner Ideen in die Stadtgesellschaft. Im Sommersemester 2023 führt sie eine Übung zur „Zeitzeugenschaft“ im Rahmen des Bündnisprojekts durch, die sowohl für Studierende als auch Schülerinnen und Schüler offensteht. Diese Übung soll den Umgang mit Zeitzeugen im Kontext der Oral History fördern.
Das Heidelberger Bündnis wird durch das Programm „Lokale Bündnisse für Überlebende von NS-Verfolgung in Deutschland“ von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ)“ gefördert und durch das Kompetenznetzwerk „Plurales Heidelberg“ unterstützt. Die Bündnispartner sind die Jüdische Kultusgemeinde Heidelberg, der Verein Mosaik Deutschland, das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, die Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg, „Heidelberger Lupe – Verein für historische Forschung und Geschichtsvermittlung“, die Theaterpädagogin und Schauspielerin Nedjma Schreiner sowie Dr. Kurt Grünberg (Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main).